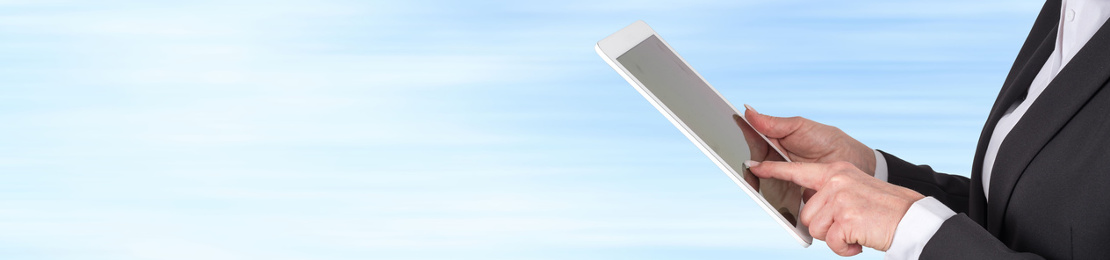2039-A
Rahmen der Einzelförderungen für das „LSBTIQ-Netzwerk in Bayern“
(LSBTIQ-Förderrahmen – LSBTIQ-FöR)
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
vom 13. Juni 2025, Az. LG/6869.02-1/1
1Alle Menschen in Bayern sollen selbstbestimmt, gleichberechtigt und frei von Diskriminierung und Gewalt leben können. 2Als Teil einer Agenda für Vielfalt und gegen Ausgrenzung werden daher die Informations-, Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Personen (LSBTIQ) in Bayern (kurz: LSBTIQ-Netzwerk in Bayern) gefördert. 3Beeinträchtigungen, Ausgrenzung oder gar Gewalt soll aktiv entgegengewirkt werden. 4Hierbei wird auf den Erfahrungen aus den vorherigen Förderzeiträumen aufgebaut.
5Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe dieser Hinweise und allgemeiner haushaltrechtlicher Bestimmungen (insbesondere der Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 der Bayerischen Haushaltsordnung – VV-BayHO) Zuwendungen für Maßnahmen zum Ausbau des LSBTIQ-Netzwerks in Bayern. 6Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
1.Zweck der Zuwendung
1Der Freistaat Bayern möchte Informations- und Anlaufmöglichkeiten für LSBTIQ, deren Angehörige sowie das nähere soziale Umfeld, Fachkräfte und die Gesellschaft zur Verfügung stellen. 2Bestehende Angebote sollen bedarfsorientiert ausgebaut werden. 3Die in diesem Bereich aktiven Organisationen sollen in einer engen Netzwerkstruktur kooperativ sowohl untereinander als auch mit Beratungsstellen der Regelstrukturen zusammenwirken, um eine bayernweite Abdeckung im Bereich der LSBTIQ-Beratungsstruktur sowie eine breite Akzeptanz für den Personenkreis zu gewährleisten.
4Dabei soll der Fokus darauf gerichtet sein, die einzelne Unterstützung oder Beratung suchende Person durch die jeweils fachlich und örtlich am besten geeignete Beratungsstelle zu betreuen. 5Durch das starke Netzwerk der Anlaufstellen soll gegebenenfalls die Verweisung der Hilfesuchenden an eine fachlich oder örtlich besser geeignete Stelle schnell und einfach möglich sein. 6LSBTIQ-Personen jeden Alters sollen geeignete Anlaufstellen für ihre Belange vorfinden können. 7Daneben besteht auch Bedarf für eine Sensibilisierung des Umfelds sowie von Fachkräften verschiedener Professionen für den Themenbereich und den Personenkreis. 8Die Fragen und Problemstellungen von LSBTIQ sind sehr heterogen und betreffen nahezu sämtliche Lebensbereiche. 9Für Fragen der geschlechtlichen Identität und sexuellen Orientierung sollen die speziellen LSBTIQ-Beratungsstellen bestehende Regelstrukturen der Beratung ergänzen.
10Ziel der Projektförderung ist es auch, bestehende Angebote und Strukturen zu ergänzen und Fachpersonal sowie Akteurinnen und Akteure zu vernetzen, um so Synergien zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden. 11Für die Einrichtung und den Betrieb der Maßnahmen werden unter Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben in diesem Zusammenhang Personalausgaben, Sachausgaben und eine Verwaltungskostenpauschale gefördert.
2.Gegenstand der Förderung; Fördersäulen
1Gefördert wird im Rahmen des Zuwendungszwecks nach Maßgabe der Nr. 1 die projektbezogene Durchführung von Maßnahmen im LSBTIQ-Netzwerk Bayern. 2Gefördert werden Maßnahmen in fünf Fördersäulen, die sich bisher bewährt haben:
2.1Fördersäule 1: Fortbildungen für Fachkräfte
- Bayernweites Angebot für Fachkräfte in der Arbeit mit LSBTIQ-Personen sowie deren sozialem Umfeld, insbesondere für Regelstrukturen (zum Beispiel Erziehungsberatung, Schuldienste).
- Modulares Fortbildungsangebot (Basiswissen LSBTIQ und bedarfsorientierte Aufbaumodule).
2.2Fördersäule 2: Anonymisierte Online- und Telefonberatung
- Bayernweite psychosoziale Beratung gegen Diskriminierung und Gewalt.
- Zentrale Anlaufstelle für Verweisberatung.
- Bayernweites Meldeverfahren Hate Speech.
- Proaktiver Beratungsansatz.
- Abstimmung und Einbindung der bestehenden (sozialen) Regelstrukturen und Hilfesysteme in Bayern.
2.3Fördersäule 3: Regionale Beratung und Anlaufstellen
- 1Psychosoziale Beratung mit überörtlichem Einzugsbereich (mindestens im Bezirk) für LSBTIQ-Personen (Erwachsene), soziales Umfeld und Fachkräfte. 2Bei Minderjährigen erfolgt bei Anliegen zu Transgeschlechtlichkeit oder Intergeschlechtlichkeit nach erster Kontaktaufnahme zwingend eine fachliche Einbeziehung einer der örtlichen Erziehungsberatungsstellen. 3Dazu soll die minderjährige Person gegebenenfalls zusammen mit ihren Erziehungsberechtigten in den direkten Kontakt mit einer örtlichen Erziehungsberatung treten. 4Es reicht nicht aus, wenn nur ein Austausch zwischen den Fachkräften der LSBTIQ-Beratungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle stattfindet. 5Die Beratung der minderjährigen Person selbst und ihrer Erziehungsberechtigten muss in erster Linie durch die Erziehungsberatungsstelle erfolgen. 6Der Erstkontakt bei der LSBTIQ-Beratungsstelle stellt keine umfassende Information im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 3 und 4 oder Abs. 2 Satz 4 des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG) dar. 7Auch bei Beratung zu schwulen, lesbischen oder bisexuellen Themen von Minderjährigen kann die Einbeziehung der Erziehungsberatungsstellen geboten sein. 8Das Vorgehen zum Umgang mit minderjährigen Beratungssuchenden ist deshalb insbesondere unter Einbeziehung der Expertise einer Erziehungsberatungsstelle vor Ort zu vereinbaren. 9Es wird empfohlen, eine Kooperationsvereinbarung mit allen Erziehungsberatungsstellen vor Ort zu schließen. 10Eine Begleitung der weiteren Beratung (multiprofessioneller Ansatz) ist möglich.
- Ergänzung bestehender Angebote und Anlaufstellen im Wirkungskreis.
- Runde Tische zur Bündelung aller Akteurinnen und Akteure und Initiativen im Wirkungskreis.
- Regionale Netzwerke zu Fachkräften, Regelstrukturen und Hilfesystemen.
2.4Fördersäule 4: (Online-)Informationsmöglichkeiten und Vernetzung bayernweiter und regionaler Akteurinnen und Akteure
- 1Bayernweites Informationsangebot zu LSBTIQ und Anlaufstellen (Bayernkarte). 2Ziel ist eine faktenbasierte, möglichst neutrale Informationsplattform. 3Meinungsaustausch ist nicht das Ziel dieser Maßnahmen.
- Konzeptioneller Ausbau eines qualitativen Netzwerks in Bayern.
- Vernetzung der in Bayern tätigen LSBTIQ-Selbstorganisationen, Initiativen und Angebote sowie einschlägiger Fachinitiativen.
- Vernetzung mit den Fachkräften weiterer Regelstrukturen und Hilfesysteme sowie Tätigkeitsfelder.
- Offenes, neutrales fachliches Forum für die im Netzwerk organisierten Akteurinnen und Akteure, Initiativen, Organisationen und Interessierte.
2.5Fördersäule 5: Modellprojekte
- 1Besonders erfolgversprechende Maßnahmen, um (psychosoziale) Beratung oder Unterstützung im Bereich LSBTIQ zu stärken. 2Überörtlicher Einzugsbereich, mindestens Bezirk als Wirkungskreis.
- Denkbar ist eine bestimmte Zielgruppenorientierung nach Alter (zum Beispiel Seniorinnen und Senioren), Fachorientierung (zum Beispiel Sozialarbeit) oder Ergänzung der bestehenden Angebote (zum Beispiel Fachberatung zu Transgeschlechtlichkeit für Kinder, Jugendliche und das familiäre Umfeld).
3.Zuwendungsempfänger
1Zuwendungsempfänger sind rechtsfähige Träger, die über die erforderliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit zur Durchführung dieser Maßnahmen verfügen, beziehungsweise deren bisherige Tätigkeit eine erfolgreiche Erfüllung des Förderzwecks erwarten lässt. 2Es werden juristische Personen, vorzugsweise mit Sitz in Bayern, für eine Antragstellung berücksichtigt. 3Es werden keine Zuwendungen an natürliche Personen ausgereicht.
4.Zuwendungsvoraussetzungen
1Verpflichtend für Träger sind:
- die aktive Mitarbeit und Zusammenarbeit im LSBTIQ-Netzwerk in Bayern, dazu zählen insbesondere die zuständigen staatlichen Stellen sowie die anderen Projekte,
- die aktive Teilnahme an etwaigen Fortbildungs-, Weiterbildungs- und Begleitmaßnahmen sowie an Evaluationsmaßnahmen sowie
- nachgewiesene Fachexpertise und, soweit möglich, Vorerfahrung.
2Für die Förderentscheidung werden folgende Kriterien berücksichtigt:
- die Weiterführung bestehender, bewährter Projekte,
- die Berücksichtigung von Kooperationen,
- nachgewiesene Fachexpertise und mögliche Vorerfahrung,
- die Vermeidung von Doppelstrukturen und der Aufbau eines bedarfsorientierten ineinandergreifenden Netzwerks,
- die Berücksichtigung bestehender Regelstrukturen und Hilfesysteme in Bayern sowie
- der überörtliche Bezug der Projekte; grundsätzlich bayernweit, mindestens in den Regierungsbezirken, insbesondere auch im ländlichen Raum.
5.Art und Umfang der Förderung
Im Rahmen von Veröffentlichungen und bei öffentlicher Kommunikation im Zusammenhang mit dem Förderbereich sowie bei direkter Kommunikation mit den Antragstellern ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Zuwendungen für das LSBTIQ-Netzwerk in Bayern freiwillige Leistungen darstellen und nur insoweit bewilligt werden können, als dafür Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und deshalb ein Zuwendungsantrag unter Umständen wegen Überzeichnung der zur Verfügung stehenden Mittel nicht bewilligt werden kann.
5.1Art der Förderung
Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung gewährt.
5.2Zuwendungsfähige Ausgaben
Zuwendungsfähig sind projektbezogene Personal- und Sachausgaben sowie eine Verwaltungskostenpauschale.
- 5.2.1
- Personalausgaben
1Grundlage für die Prüfung (Vergleichsberechnung) der Kappung bilden die Eingruppierungsmerkmale des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und die darauf basierenden Personalausgabenhöchstsätze des StMFH. 2Die Höhe der maximal zuwendungsfähigen Personalausgaben pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) bemisst sich nach den jährlich vom StMFH veröffentlichten Personalausgabenhöchstsätzen. 3Ist der tatsächliche Lohn beim Zuwendungsempfänger geringer als der festgelegte Höchstsatz, ist der tatsächlich niedrigere Lohn als Höchstsatz heranzuziehen. 4Wird zuwendungsfähiges Personal auch in anderen Bereichen oder bei anderen Maßnahmen des Zuwendungsempfängers eingesetzt, werden die Personalausgaben entsprechend anteilig berücksichtigt; ein Stundennachweis beziehungsweise Arbeitszeitaufzeichnungen des im Projekt beschäftigten Personals ist vorzuhalten.
5Die Tätigkeitsbereiche des Eigenpersonals im Projekt sind grundsätzlich mit nachstehender Eingruppierung nach dem TV-L vergleichbar und förderfähig:
- Fördersäule 1: Fortbildungen für Fachkräfte
- Fachkraft Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder ähnliches Personal: bis zu 2,0 VZÄ (entsprechend den Entgeltgruppen S 8b bis S 11b TV-L)
- Verwaltungs-, Sachbearbeitungskräfte oder ähnliches Personal: bis zu 0,4 VZÄ (entsprechend E 3 bis E 8 TV-L)
- Fördersäule 2: Anonymisierte (Online-)Beratung
- Fachkraft Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder ähnliches Personal: bis zu 2,0 VZÄ (entsprechend den Entgeltgruppen S 8b bis S 11b TV-L)
- Verwaltungs- und Sachbearbeitungskräfte, Buchhaltungskräfte oder ähnliches Personal: bis zu 0,13 VZÄ (entsprechend E 3 bis E 8 TV-L)
- Fördersäule 3: Regionale Beratung und Anlaufstellen
- Fachkraft Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder ähnliches Personal: bis zu 0,75 VZÄ (entsprechend den Entgeltgruppen S 8b bis S 11b TV-L)
- Verwaltungs- und Sachbearbeitungskräfte, Buchhaltungskräfte oder ähnliches Personal: bis zu 0,13 VZÄ (entsprechend E 3 bis E 8 TV-L)
- Fördersäule 4: (Online-)Informationsmöglichkeiten und Vernetzung bayernweiter und regionaler Akteurinnen und Akteure
- Projektkoordination, Projektleitung oder ähnliches Personal: bis zu 1,0 VZÄ (entsprechend den Entgeltgruppen E 9a bis E 12 TV-L)
- Fachkräfte für Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit: bis zu 0,5 VZÄ (entsprechend den Entgeltgruppen E 8 bis E 11 TV-L), bei geringerem Umfang der Projektkoordination oder Projektleitung entsprechend höherer Zeitanteil möglich.
- Verwaltungs-, Sachbearbeitungskräfte oder ähnliches Personal: bis zu 0,5 VZÄ (entsprechend E 3 bis E 9a TV-L)
- Fördersäule 5: Modellprojekte
- Fachkraft Soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder ähnliches Personal: bis zu 0,5 VZÄ (entsprechend den Entgeltgruppen S 8b bis S 11b TV-L, beziehungsweise E 9a bis E 11 TV-L)
- Verwaltungs- und Sachbearbeitungskräfte, Buchhaltungskräfte oder ähnliches Personal: bis zu 0,13 VZÄ (entsprechend E 3 bis E 8 TV-L).
6Abweichungen sind ausschließlich in besonders begründeten Einzelfällen möglich.
7Die Förderung von Personalausgaben entfällt, solange eine Stelle nicht besetzt ist oder wegen Krankheit, Elternzeit oder Ähnlichem ein tariflicher oder gesetzlicher Entgeltanspruch nicht oder nicht mehr besteht.
- 5.2.2
- Sachausgaben
Zuwendungsfähige Sachausgaben sind insbesondere
- 1. Honorare für Supervision, Coaching und ähnliche qualitätssichernde Maßnahmen für Fachkräfte,
- 2. Reiseausgaben nach Maßgabe des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG),
- 3. Anschaffung oder Leasing von technischen Geräten (zum Beispiel Computer mit Zubehör oder Telefon),
- 4. Anschaffung oder Leasing geringwertiger Wirtschaftsgüter (zum Beispiel Büromöbel oder Besprechungsmobiliar),
- 5. Raumausgaben für Einzelveranstaltungen,
- 6. Mietausgaben für projektbezogen genutzte Geschäftsräume sowie damit verbundene Nebenausgaben (zum Beispiel Strom und Reinigung),
- 7. Bewerbung der Maßnahmen (zum Beispiel Flyer, Roll Ups),
- 8. Honorare für die Erstellung und Pflege von Inhalten haptisch und digital,
- 9. projektbezogene Fachliteratur.
- 5.2.3
- Verwaltungskostenpauschale
1Die Verwaltungskostenpauschale dient der Verwaltungsvereinfachung und Wirtschaftlichkeit. 2Sie beträgt in der Regel 5 % der zuwendungsfähigen Personal- und Sachausgaben. 3In begründeten Fällen kann die Verwaltungskostenpauschale auf bis zu 15 % erhöht werden, wenn die Erhöhung inhaltlich oder fachlich begründet werden kann; bereits nach Nr. 5.2.1 oder 5.2.2 berücksichtigte Ausgaben sind von der Verwaltungskostenpauschale ausgeschlossen. 4Die Verwaltungskostenpauschale darf nur für tatsächliche Ausgaben veranschlagt und bewilligt werden. 5Belege sind entsprechend aufzubewahren. 6Mit der Verwaltungskostenpauschale werden dem Projekt zuzurechnende Ausgaben abgegolten, die allgemein für das Projekt in der Durchführung anfallen, zum Teil geringe Ausgaben verursachen oder deren (anteiliger) Projektbezug nur mit erhöhtem Aufwand dem Projekt zugeordnet werden können. 7Dazu zählen
- personalbezogener Verwaltungsaufwand (zum Beispiel Leitung und Anleitung des Projektpersonals, Personalaufwand zur Personalverwaltung, entsprechende Lizenzen für Programme, Einrichtung von E-Mail-Adressen)
- Verbrauchsgüter, Telekommunikation und ähnliche laufende Ausgaben (zum Beispiel Kopierpapier, Gerätenutzung, Stifte, Internet- und Telefonverträge)
- Ausgaben, die bereits als zuwendungsfähige Sachausgaben (Nr. 5.2.2) zur Förderung beantragt werden, dürfen nicht bei der Beantragung und Bemessung der Verwaltungskostenpauschale angesetzt werden.
8Auf das FMS vom 26. Februar 2025 wird verwiesen. 9Die Verwaltungskostenpauschale kann für alle Träger angewandt werden; alle in Frage kommende Gemeinkosten fallen dem Grunde nach an, da für Einrichtung und Betrieb aller Projekte oben genannte Ausgaben unvermeidbar sind und bei Anwendung der Verwaltungskostenpauschale nicht anderweitig, als Sachausgaben gemäß Nr. 5.2.2, berücksichtigt werden.
5.3Höhe der Förderung
Die Förderung beträgt in der Regel 90 % der nach Nr. 5.2 ermittelten zuwendungsfähigen Ausgaben für juristische Personen des Privatrechts, beziehungsweise 75 % der nach Nr. 5.2 ermittelten zuwendungsfähigen Ausgaben für juristische Personen des öffentlichen Rechts.
6.Eigenanteil
1Von juristischen Personen des Privatrechts (zum Beispiel e. V., gGmbH, GmbH) werden Eigenmittel in Höhe von in der Regel 10 % erwartet. 2Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts (zum Beispiel Kommunen) werden Eigenmittel in Höhe von mindestens 25 % erwartet. 3Nicht zuwendungsfähige Ausgaben müssen durch Eigen- oder Drittmittel aufgebracht werden. 4Teilnahmebeiträge, Bußgeldzuweisungen, (projektbezogene) Spenden können als Eigenmittel berücksichtigt werden. 5Eigenleistungen können im Rahmen von VV Nr. 2.4.1 zu Art. 44 BayHO berücksichtigt werden.
7.Mehrfachförderung
1Eine Komplementärförderung mit Mitteln der Kommune, des Bundes oder der Europäischen Union ist möglich, sofern es sich dabei um inhaltlich gleichartige Fördermaßnahmen handelt. 2Gewähren vorgenannte Stellen ebenfalls Zuwendungen und übersteigt die Gesamtzuwendung dadurch 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, so ist die Förderung vorrangig nach dieser Richtlinie zu kürzen.
8.Antrags- und Bewilligungsverfahren
Die Entscheidung über die konkrete Höhe der Zuwendung obliegt der Bewilligungsbehörde im Einzelfall.
8.1Bewilligungszeiträume
Bewilligungszeitraum ist grundsätzlich die Zeit vom
- 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027 und
- 1. Januar 2028 bis 31. Dezember 2029.
8.2Antragsverfahren
1Bisherige Projekte können einen Antrag auf Anschlussbewilligung bei der Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS, Winzererstraße 9, 80797 München) einreichen; an einer Antragstellung interessierte Organisationen können der Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern im StMAS digital eine aussagekräftige Projektskizze zusenden (LG_Buero@stmas.bayern.de). 2Neben dem Projektkonzept ist zur Antragstellung der bei der Bewilligungsbehörde erhältliche Vordruck zu verwenden. 3Dem Antrag sind neben der ausführlichen Projektbeschreibung eine Beschreibung der Struktur (zum Beispiel Auszug aus dem Vereinsregister, Kooperationsvereinbarungen, Personal-, Raum- und Sachmittelausstattung, Personalwirtschaft), der Prozess- und Ergebnisqualität (zum Beispiel Darlegung des Zugangs zur Zielgruppe, quantitative und qualitative Zielmarken) und eine Verpflichtung zur Dokumentation beizulegen. 4Auf Grundlage des gestellten Antrags und der im Rahmen des Prüfungsverfahrens gegebenenfalls mitgeteilten Änderungen erlässt die Bewilligungsbehörde einen Zuwendungsbescheid. 5Dieser steht unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse nach Bescheiderlass. 6Die Bewilligungsbehörde kann bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß VV Nr. 1.3.3 zu Art. 44 BayHO auf Antrag die Einwilligung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn erteilen.
7Anträge werden von der Leitstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern im StMAS inhaltlich bewertet, die weitere Abwicklung der Förderung erfolgt durch das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) als Bewilligungsbehörde.
8.3Abschlagszahlungen
1Die Abschlagszahlungen richten sich nach Nr. 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) beziehungsweise Nr. 1.3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K). 2Auszahlungen nach VV Nr. 7.2.2 zu Art. 44 BayHO sind zugelassen. 3Die letzte Abschlagszahlung im Kalenderjahr wird spätestens am 30. November des Jahres ausgereicht.
9.Verwendungsnachweis
1Der Nachweis über die Verwendung der staatlichen Zuwendung richtet sich nach Nr. 6 ANBest-P beziehungsweise Nr. 6 ANBest-K und ist unter Verwendung der bei der Bewilligungsbehörde erhältlichen Vordrucke zu erstellen. 2Es werden halbjährliche Zwischenberichte, Jahresverwendungsnachweise und Gesamtverwendungsnachweise angefordert.
9.1Zwischenbericht
Dem StMAS ist ein halbjährlicher Sachbericht als Zwischenbericht bis spätestens zum 31. Juli des Jahres in digitaler Form vorzulegen.
9.2Jahres- und Gesamtverwendungsnachweis
1Die Bewilligungsbehörde prüft für den jeweiligen Bewilligungszeitraum die Verwendungsnachweise in eigener Zuständigkeit und Verantwortung. 2Der Nachweis über die Verwendung der staatlichen Zuwendung, der aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis besteht, ist grundsätzlich spätestens am 31. März 2027 beziehungsweise 2029 (Jahresverwendungsnachweis) und für den Gesamtbewilligungszeitraum bis spätestens 31. März 2028 beziehungsweise 2030 (Gesamtverwendungsnachweis) vorzulegen, sofern seitens der Bewilligungsbehörde kein abweichender Termin festgelegt wird. 3Auf Nr. 6 ANBest-P sowie Nr. 6 ANBest-K wird verwiesen. 4Sofern sich die Angaben aus dem ersten Durchführungsjahr gegenüber dem Jahresverwendungsnachweis nicht geändert haben oder Unterlagen bereits eingereicht wurden, kann der Gesamtverwendungsnachweis gegenüber dem Jahresverwendungsnachweis ergänzt werden. 5Der Sachbericht ist als Abdruck in digitaler Form dem StMAS vorzulegen.
10.Prüfungsrecht
Der Bayerische Oberste Rechnungshof ist gemäß Art. 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BayHO berechtigt, bei den Zuwendungsempfängern zu prüfen.
11.Datenschutz
1Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 (EU-Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) einzuhalten. 2Die Bewilligungsbehörde ist Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO. 3Die Verpflichtungen aus der DSGVO (insbesondere die Betroffenenrechte und die Informationspflichten gemäß Art. 13 folgende DSGVO) werden von der Bewilligungsbehörde erfüllt.
12.Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2029 außer Kraft.
Dr. Markus Gruber
Ministerialdirektor