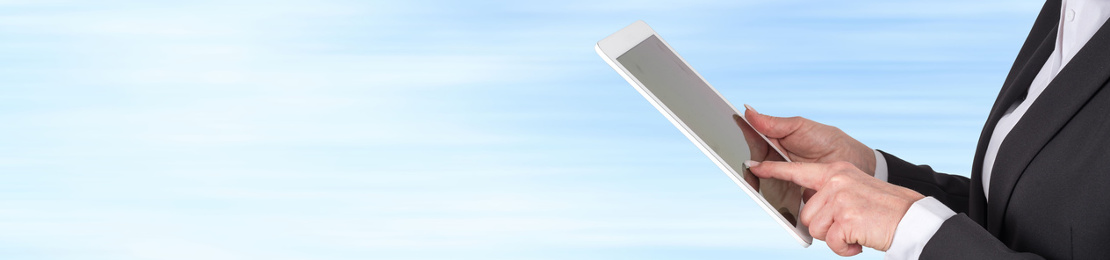2126.1-K
Richtlinien für Suchtprävention an bayerischen Schulen
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 28. Oktober 2025, Az. VI.8-BS4363.3/87/1
1.Grundsätze der schulischen Suchtprävention
1Der Konsum von Suchtmitteln sowie Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial wie Medienkonsum sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. 2Die langfristigen Folgen können gravierend sein und mit gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Schäden einhergehen. 3Dabei spielen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle und beeinflussen sowohl die Lebenswelten als auch die individuellen Risiko- und Schutzfaktoren. 4Auch vor dem Hintergrund immer neuer Trends und Entwicklungen im Bereich der Suchtmittel sowie Verhaltens- bzw. Konsummuster trägt die schulische Suchtprävention eine besondere Verantwortung für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
5Suchtprävention will gesundheitliche Ressourcen stärken, Lebenskompetenzen fördern, relevantes Wissen vermitteln und konkrete Krankheitsrisiken vermeiden. 6Dabei nimmt sie die Gesamtheit von riskanten, missbräuchlichen, gesundheitsschädlichen und abhängigen Verhaltensweisen in Bezug auf legale und illegale Suchtmittel sowie nichtstoffgebundene und riskante Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial in den Blick. 7Erfolgreiche Suchtprävention braucht eine Gesamtstrategie und keine isolierten Einzelmaßnahmen. 8Grundlage sind langfristig angelegte, verzahnte Konzepte der Verhaltens- und Verhältnisprävention, die die gesamte Schulfamilie in die Maßnahmengestaltung einbinden. 9Dazu gehören neben den Schülerinnen und Schülern beispielsweise auch die Eltern, Lehr- und Fachkräfte, die Schulleitung sowie anderes schulisches Personal. 10Beispielsweise ergibt sich aus dem Ineinandergreifen von Erziehungsrecht der Eltern, Erziehungsrecht des Staates und Persönlichkeitsrecht der Schülerinnen und Schüler die Notwendigkeit einer engen und vertrauensvollen Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule.
11Präventionsarbeit ist eine wichtige Aufgabe der Schule, denn sie bietet niedrigschwellige Zugangswege, über die im Sinne der gesundheitlichen Chancengleichheit alle Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern frühzeitig und stigmatisierungsarm zu erreichen sind.
2.Maßnahmen der schulischen Suchtprävention
Schulische Suchtprävention agiert auf verschiedenen Ebenen und setzt an den strukturellen Rahmenbedingungen sowie am Verhalten von Individuen an.
- 2.1
- Strukturelle Maßnahmen
1Die Schule ist eine zentrale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. 2In ihr können elementare Grundlagen für ein positives Gesundheitsverhalten und gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen gelegt werden. 3Im Sinne der Verhältnisprävention sollte Schule daher so gestaltet sein, dass sie die Gesundheit und das Wohlbefinden der gesamten Schulfamilie im Alltag fördert. 4Dazu zählt beispielsweise eine Umgebung, in der positive soziale Kontakte gefördert und gesundheitliche Belastungen wie Stress oder Mobbing aktiv reduziert werden. 5Positive Veränderungen des Schulklimas können beispielsweise durch Fortbildungen für Lehrkräfte unterstützt werden. 6Hinsichtlich Substanzkonsum und Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial (beispielsweise die Mediennutzung) ist eine gemeinsame und einheitliche Grundhaltung die Grundlage für ein abgestimmtes und adäquates Handeln. 7Dies macht die Entwicklung und Implementierung von schulischen Vereinbarungen mit Handlungsleitlinien sowie die Definition von verbindlichen Regeln, u. a. bei Schulfesten und Schulfahrten, und transparenten Kommunikationswegen zu zentralen Instrumenten der erfolgreichen Prävention.
- 2.2
- Verhaltenspräventive Maßnahmen
1Die Ziele schulischer Suchtprävention werden im Unterricht mehrerer Fächer, in den Unterricht ergänzenden Projekten sowie dem Schulleben insgesamt gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie verwirklicht. 2Die empfohlenen Inhalte unterscheiden sich je nach Alter und Konsumerfahrung der Schülerinnen und Schüler.
- 2.2.1
- Förderung von Lebenskompetenzen
1Bei Kindern und jüngeren Jugendlichen haben sich vor allem universelle Präventionsmaßnahmen mit substanz-unspezifischen Inhalten als altersgerecht und wirksam erwiesen. 2Dazu zählt die Förderung von Lebenskompetenzen, wie beispielsweise gute Problemlöse- und Kommunikationsfähigkeiten, Selbstsicherheit und Durchsetzungsvermögen. 3Die Entwicklung dieser sozialen und personalen Kompetenzen geschieht im Miteinander des Schullebens und ist Aufgabe aller Fächer. 4Sie wird situationsbezogen auch in den höheren Jahrgangsstufen fortgesetzt.
5Da Schülerinnen und Schüler tagtäglich mit den Herausforderungen digitaler Medien konfrontiert werden, spielt die Prävention bezogen auf Medienkonsum, insbesondere im Hinblick auf Internetnutzung, Computerspiele und Onlinekommunikation eine entscheidende Rolle. 6Über alle Jahrgangsstufen und Fächer hinweg wird daher im Rahmen der Medienbildung bzw. Digitalen Bildung proaktiv zu den Chancen und Risiken digitaler Medien aufgeklärt und werden Medienkompetenzen für einen bewussten, kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Inhalten gefördert.
- 2.2.2
- Substanzspezifische Aufklärung und Kompetenzförderung
1Schülerinnen und Schüler profitieren zudem von Präventionsmaßnahmen mit substanzspezifischen Inhalten. 2Dazu gehören die sachliche Aufklärung und Information über die Risiken des Konsums von Suchtmitteln, die den Schülerinnen und Schülern bekannt sind oder zu denen sie Fragen haben. 3In den unteren Jahrgangsstufen wird in erster Linie auf die legalen Suchtmittel wie Nikotin (Rauchen einschließlich alternativer – insbesondere elektronischer – Rauchprodukte sowie anderer nikotinhaltiger Produkte), Alkohol und den Missbrauch von Medikamenten eingegangen. 4Ab der Mittelstufe wird zusätzlich insbesondere Cannabis thematisiert und neue psychoaktive Substanzen sowie illegale Drogen in die Besprechung einbezogen. 5Besondere Bedeutung kommt im Bereich der suchtmittelspezifischen Aufklärung den Fächern Heimat- und Sachunterricht (HSU), Natur und Technik, Biologie, Physik/Chemie/Biologie (PCB), aber auch Religionslehre, Ethik, Deutsch, Politik und Gesellschaft sowie Sport zu.
6Von Abschreckung durch die Darstellung von Schreckensszenarien ist allgemein abzusehen, da diese zu Neugier und dadurch zu Konsumbereitschaft führen können (beispielsweise können sie für Jugendliche, die sich von Risiken, Gefahren und neuen Eindrücken angezogen fühlen, attraktiv sein und zum Konsum anregen). 7Informationen sollten daher immer sachlich und differenziert vermittelt werden.
8Hintergrundinformationen zu verschiedenen Suchtmitteln sowie Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial bieten die Web-Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention sowie des Bayerischen Zentrums für Prävention und Gesundheitsförderung im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.
9In der modernen Suchtprävention wird der Ansatz der Aufklärung, Wissensorientierung oder Informationsvermittlung über Substanzen, Substanzkonsum, Wirkung und Risiken als notwendig, aber nicht hinreichend erachtet, um Verhalten zu beeinflussen. 10Daher sollte die Förderung der Lebens- und Risikokompetenzen und Stärkung der Selbstkontrolle immer Teil des Unterrichts und der den Unterricht ergänzenden Programme sein. 11Beispiele sind motivierende Kurzinterventionen zur Stärkung der Motivation zur Konsumreduktion oder -beendigung bei Konsumierenden, aber auch Standfestigkeitstrainings, um sozialen Druck zum Substanzkonsum zu erkennen und Standfestigkeit gegen sozialen Druck zu entwickeln.
3.Qualitätsgesicherte Umsetzung von suchtpräventiven Maßnahmen
1Der Einsatz von Programmen zur Ergänzung des Unterrichts, die entsprechend aktueller Evidenz und Qualitätsstandards agieren sowie wissenschaftlich nachgewiesen wirksam sind, trägt entscheidend zu guter Suchtprävention an Schulen bei.
2Schulische Suchtprävention folgt einem systematischen Prozess von der Analyse der Ausgangssituation und des Bedarfs über die Planung und Umsetzung der Maßnahme bis hin zur erforderlichen Auswertung. 3Oftmals ist die Neukonzeption einer Intervention allerdings nicht notwendig, da bereits eine geeignete Maßnahme besteht: Es gibt viele wissenschaftlich geprüfte und in der Praxis erprobte suchtpräventive Maßnahmen, die nachgewiesenermaßen oder wahrscheinlich effektiv und nützlich sind – und keine unbeabsichtigten Wirkungen zur Folge haben. 4Für den Einsatz empfohlene Programme sind in einschlägigen Datenbanken wie der Grünen Liste Prävention sowie auf den Web-Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus und des Bayerischen Zentrums für Prävention und Gesundheitsförderung im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aufgeführt.
4.Organisation der Suchtprävention an der Schule
1Suchtprävention ist ein bedeutender Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule, erfordert das Zusammenwirken aller Mitglieder der Schulfamilie und soll daher regelmäßig u. a. in Lehrerkonferenzen, im Schulforum, auf Sitzungen des Elternbeirats oder im Rahmen von Treffen der Schülermitverwaltung thematisiert und gemeinsam weiterentwickelt werden. 2Im Folgenden werden die verschiedenen Akteure der schulischen Suchtprävention mit ihren Handlungsbereichen beschrieben.
- 4.1
- Schulleitung
1Die Schulleiterin oder der Schulleiter sorgt für die Einhaltung der Richtlinien zur Suchtprävention an der Schule.
2Die Schulleiterin oder der Schulleiter benennt an jeder weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schule eine(n) Beauftragte(n) für die Suchtprävention, gibt die Kontaktdaten Eltern und Schülerinnen und Schülern bekannt und unterstützt die Arbeit des/der Beauftragten für die Suchtprävention.
- 4.2
- Beauftragte für die Suchtprävention
1Aufgaben des/der Beauftragten für die Suchtprävention:
- Er/Sie ist Schlüsselperson, Multiplikator/-in und Koordinator/-in für die Suchtprävention an der Schule.
- 1Mithilfe der vielfältigen Materialien zur Suchtprävention, die bei den für die gesundheitliche und suchtpräventive Aufklärung und Kompetenzförderung zuständigen Behörden und Institutionen Bayerns und des Bundes zur Verfügung stehen, sowie durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen eignet er/sie sich das nötige Fachwissen an. 2Er/Sie kennt die einschlägigen Gesetze und Verordnungen. 3Er/Sie vermittelt das erworbene Wissen in der schulinternen Fortbildung an seine/ihre Kolleginnen und Kollegen und informiert über entsprechende Aufklärungsmaterialien, Literatur und Lehrmittel einschließlich digitaler Medien für den Unterricht.
- 1Er/Sie hält Kontakt zu den Fachkräften der Staatlichen Schulberatung (der Schulpsychologe bzw. die Schulpsychologin, die Beratungslehrkraft an der Schule), der Schulsozialpädagogik, und der Jugendsozialarbeit an Schulen, der nächstgelegenen psychosozialen Beratungsstelle, der Fachkraft für Suchtprävention in der Kommune und dem regionalen Suchtarbeitskreis, um stets über Präventions- und Hilfsangebote im Einzugsbereich der Schule sowie aktuelle Themenschwerpunkte informiert zu sein. 2Zur Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und am Erfahrungsaustausch in den regionalen Suchtarbeitskreisen ist dem/der Beauftragten für die Suchtprävention nach Möglichkeit Dienstbefreiung zu gewähren. 3Um eine langfristig erfolgreiche Suchtprävention zu erreichen, stimmt er/sie mit der Schulleitung, den Lehrkräften der Schule und allen weiteren Akteuren die unterschiedlichen Angebote zum Auf- und Ausbau personaler sowie sozialer Kompetenzen aufeinander ab. 4In diesem Rahmen wird eine Gesamtstrategie zur Suchtprävention an der Schule gemeinsam aufgebaut, umgesetzt und weiterentwickelt.
- 1Im Auftrag der Schulleitung organisiert er/sie von Fall zu Fall und ggf. unter Einbezug der weiteren oben genannten Akteure Schulveranstaltungen (Elternabende, Projekttage, schulinterne Lehrerfortbildungen u. a.) zum Thema Suchtprävention. 2Dabei bezieht er/sie weitergehende Themen wie z. B. Essstörungen mit ein. 3Er/Sie versucht, Fachleute zu gewinnen, die bereit sind, bei diesen Veranstaltungen als Referenten mitzuwirken. 4Beispielsweise stehen den Schulen mit dem Netzwerk Beratung digitale Bildung in Bayern (BdB) qualifizierte Ansprechpersonen für medienpädagogische und informationstechnische Fragestellungen zur Verfügung.
- 1Durch die Kenntnis der zu beschreitenden Wege und der örtlichen Beratungs- und Hilfsangebote unterstützt er/sie die Schulleitung, Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schüler bei Hinweisen auf eventuelle Suchterkrankungen an der Schule. 2Im Bedarfsfall stellt er/sie die Verbindung zu dem/der Schulpsychologen/-in her.
2Es gilt jedoch zu beachten, dass der/die Beauftragte für die Suchtprävention für betroffene Schülerinnen und Schüler weder die Lehrkraft ihres besonderen Vertrauens noch eine Sucht-, psychologische oder ärztliche Beratung ersetzen kann. 3Die Aufgaben des/r Beauftragten für die Suchtprävention entbinden die anderen Lehrkräfte an der Schule nicht von ihrer unmittelbaren und eigenständigen Erziehungsverantwortung. 4Auch bei Suchtproblemen muss sich der Schüler/die Schülerin an die Lehrkraft seines/ihres besonderen Vertrauens wenden können.
- 4.3
- Schulpsychologie
Die Staatliche Schulpsychologin bzw. der Staatliche Schulpsychologe unterstützt durch geeignete Beratungsangebote und psychologische Interventionen bei Schülerinnen und Schülern mit einer Suchtproblematik und vermittelt ggf. weitergehende Beratungsmaßnahmen.
- 4.4
- Lehrkräfte
1Die in den Klassen unterrichtenden Lehrkräfte vermitteln im jeweiligen Fachunterricht die im Lehrplan verankerten Themenbereiche der Suchtprävention. 2Die dafür notwendigen Absprachen koordiniert die Klassenleitung oder bei Bedarf der/die Beauftragte für die Suchtprävention.
3Um ihren Erziehungsauftrag gewissenhaft zu erfüllen, müssen alle Lehrkräfte um stetige Information und Fortbildung zu Fragen der Suchtprävention bemüht sein. 4Es liegt im dienstlichen Interesse, dass die Lehrkräfte die einschlägigen Angebote der staatlichen zentralen und regionalen Lehrerfortbildung nutzen.
- 4.5
- Schulsozialpädagogik und Jugendsozialarbeit an Schulen
1Schulsozialpädagoginnen und -pädagogen bringen sozialpädagogische Kompetenz und einen ganzheitlichen Blick auf die Schülerinnen und Schüler sowie auf die Klasse mit sich. 2Sie unterstützen die Erziehungsarbeit der Schule durch gruppenbezogene Prävention beispielsweise durch die Vorbereitung, Koordinierung und Umsetzung von suchtpräventiven Maßnahmen in Schulklassen.
3Die Jugendsozialarbeit an Schulen bringt bei der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern ebenfalls eine sozialpädagogische Sichtweise ein und agiert mit dem gesamten System der Jugendhilfe. 4Beratung und sozialpädagogische Hilfe erfolgt in Einzel- oder auch Gruppengesprächen.
- 4.6
- Nichtpädagogisches Personal
Auch nichtpädagogisches Personal wie z. B. das Gebäudemanagement, die Hausverwaltung und weiteres technisches sowie sonstiges Schulpersonal sind wichtige Akteure für die Gestaltung gesundheitsförderlicher Strukturen und Bedingungen in der Schule.
- 4.7
- Elternvertretungen
1Das familiäre Umfeld hat einen großen Einfluss auf das gesunde Auf- und Heranwachsen, einschließlich dem Umgang mit Suchtmitteln und Verhaltensweisen mit Abhängigkeitspotenzial. 2Die Familie kann dabei einen wichtigen Schutzfaktor und eine Ressource, aber auch einen Risikofaktor darstellen. 3Eltern und Erziehungsberechtigte sollten für ihre Vorbildrolle sensibilisiert, ihre Erziehungs- und Beziehungskompetenzen gefördert und sie so beim präventionsorientierten Handeln unterstützt werden. 4Die Elternvertretung ist daher an den Präventionsbemühungen der Schule zu beteiligen.
- 4.8
- Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen
1Das Hinzuziehen außerschulischer Expertise unterstützt den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 2Insbesondere bei geeigneten Anlässen können daher in den Unterricht oder zu Elternabenden Fachleute aus der Praxis einbezogen werden. 3Dafür kommen u. a. kommunale und sonstige Suchtpräventionsfachkräfte, Fachkräfte aus Medizin und Psychotherapie, aus der Jugendarbeit, der Polizei, der BLM Stiftung Medienpädagogik Bayern und weiteren Behörden in Betracht.
4Im Rahmen von Peer-to-Peer-Projekten (u. a. Medienscouts, Netzgänger) werden unter Einbeziehung regionaler außerschulischer Einrichtungen nachhaltige Unterstützungsangebote entwickelt und umgesetzt.
5Darüber hinaus empfiehlt es sich, lokale und regionale Beratungs- und Unterstützungsangebote auf der Homepage der Schule leicht auffindbar zugänglich zu machen.
- 4.9
- Schulentwicklung
1Im Rahmen eines kontinuierlichen Entwicklungsprozesses ist die Schulentwicklung ein wichtiger Bestandteil, um den Aufbau und die Optimierung von Strukturen, die Qualifizierung aller Beteiligten, proaktive Elternarbeit und konkrete Maßnahmen wie Workshops zu initiieren und zu unterstützen. 2Damit trägt sie maßgeblich zur schulischen Suchtprävention im Sinne der Verhaltens- und Verhältnisprävention bei.
5.Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 28. Oktober 2025 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 27. Oktober 2030 außer Kraft. 2Mit Ablauf des 27. Oktober 2025 tritt die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst über die Suchtprävention an den bayerischen Schulen vom 2. September 1991 (KWMBl. I S. 303), die durch Bekanntmachung vom 23. Mai 1996 (KWMBl. I S. 214) geändert worden ist, außer Kraft.
Martin Wunsch
Ministerialdirektor